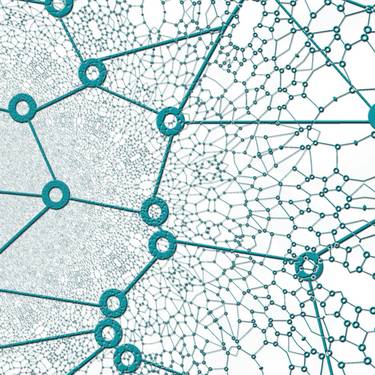Projekt auf einen Blick
Destinations-Management-Organisationen (DMOs) stehen vor vielfältigen Herausforderungen: Unterschiedliche Interessen und Erwartungen der Stakeholder und sich verändernde Ansprüche erschweren die Zusammenarbeit. Die DMO selbst ist in den finanziellen und personellen Ressourcen beschränkt und muss diese entsprechend zielgerichtet einsetzen. Zudem müssen sich Destinationen aufgrund laufender Veränderungen im Marktumfeld ständig anpassen. Dies kann das System schwerfällig werden lassen.
Das Projekt zielt darauf ab, DMOs dabei zu unterstützen, ihre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Interessengruppen weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen. Dadurch soll die Zusammenarbeit zwischen DMOs und verschiedenen Interessengruppen gestärkt und die Agilität, sowie damit verbunden die Wettbewerbsfähigkeit, erhöht werden.
Projekt
Neue Wege im Stakeholder-Management von touristischen DestinationenLead
Institut für Tourismus und Freizeit (ITF) Mehr über Institut für Tourismus und Freizeit (ITF)Projektleitung
Trepp Gian-Reto Mehr über Trepp Gian-RetoTeam
Kalberer Sindy Mehr über Kalberer Sindy Knaus Dominik Mehr über Knaus Dominik Stuhlmüller Miriam Mehr über Stuhlmüller MiriamForschungsfelder
Touristische Lebensräume Mehr über Touristische LebensräumeAuftrag/Finanzierung
Neue Regionalpolitik (NRP); Projekt- und Umsetzungspartner: Heidiland Tourismus, St.Gallen-Bodensee Tourismus, Toggenburg Tourismus und Thurgau TourismusDauer
April 2025 – Juni 2026
Ausgangslage
Die erfolgreiche Involvierung (relevanter) Stakeholder einer Destination trägt massgeblich zum Erfolg der Aktivitäten der Destinations-Management-Organisation (DMO) bei, da sie selbst als Netzwerkorganisation keinen direkten Einfluss auf die touristische Wertschöpfungskette und das Leistungsbündel des touristischen Produkts hat. Dennoch muss sie die Destination strategisch steuern und als Wettbewerbseinheit führen, um einen Erfolg auf dem Markt realisieren zu können.
Durch die Einbettung in gesamträumliche Kontexte wie Region und Politik, sowie von vor- und nachgelagerten Tourismusstrukturen, haben die Aktivitäten der DMO weitreichende Einflüsse auf das Umfeld der Destination. Es bestehen somit eine Vielzahl an unterschiedlicher Interessen gegenüber der DMO, während sie gleichzeitig durch ihren begrenzten Handlungs- und Gestaltungsspielraum vom Kooperationswillen der Leistungsträger und anderen Akteuren abhängig ist. Es wird angenommen, dass Stakeholder motivierter sind Beiträge zu leisten, je mehr ihre persönlichen Anliegen in den Aktivitäten der Organisation berücksichtigt werden. Da alle Akteure auch eigene Interessen verfolgen, resultiert dies in einen permanenten Verhandlungsprozess und einer ständigen Positionierung der Organisationen im touristischen Netzwerk.
Durch effektives Stakeholder-Management können die Kooperationsbereitschaft, Legitimation, Akzeptanz, Reputation, sowie Handlungsspielräume aufrechterhalten und gesichert werden. Dies wiederum führt zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs, sowie der systematischen Zukunftssicherung der Destination. In der Praxis stossen DMOs im Rahmen ihrer operativen Arbeit jedoch auf externe und interne Herausforderungen:
Externe Herausforderungen
- Destinationen weisen eine heterogene Leistungsträger- und Angebotsstruktur auf;
- Stakeholder tragen heterogene bis konfliktäre Interessen an das Destinationsmanagement heran;
- Stakeholder verfolgen primär eigene Interessen, es fehlt das Bewusstsein für den Bedarf eines gemeinsamen Ziels;
- Fehlende Identifikation der Stakeholder mit der Destination;
- Es bestehen hohe Erwartungen an eine DMO, obwohl diese keinen direkten Einfluss auf die Wertschöpfungskette hat;
- Fehlendes Wissen von Stakeholdern über DMO-Tätigkeiten, sowie Kooperationsmöglichkeiten.
Interne Herausforderungen
- Fehlende hierarchische Strukturen: DMOs können nur durch Anreize und den Einfluss im Netzwerk Wirkungen erzielen;
- Eingeschränkte finanzielle und personelle Ressourcen einer DMO;
- Fehlendes Know-How im Bereich des Stakeholder-Managements.
Diese Umstände erschweren ein zukunftsgerichtetes, proaktives, sowie agiles Handeln und Wirken einer DMO im Sinne einer zentralen Service- und Netzwerkorganisation. Durch unkoordinierte Einzelmassnahmen und -strategien in den Destinationen, können Potenziale und Ressourcen nicht effizient genutzt werden. Dies erschwert zentrale Aufgaben wie beispielsweise die Produktentwicklung. Die Aktivierung und Sensibilisierung von Interessensgruppen in touristischen Netzwerken ist daher eine zentrale Aufgabe einer DMO und für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Projektpartner und Schwerpunkte
Die Projektinhalte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Projektpartnern erarbeitet. Es ergeben sich daher spezifische Schwerpunkte pro Destination:
- Heidiland Tourismus: Onboarding und koordinierte Partnerpflege touristischer Leistungsträger
- St.Gallen-Bodensee Tourismus: Valorisierung der Aktivitäten für Stakeholder
- Toggenburg Tourismus: Ansprache Stakeholder mit Fokus Sensibilisierung und Rollenverständnis
- Thurgau Tourismus: Management von schwer erreichbaren Stakeholdern
Projektziel
Das Projekt trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen DMOs und Stakeholdern zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen zu stärken. Durch die Entwicklung von praxisorientierten Lösungen und die Einbindung der Projektpartner wird ein nachhaltiger Erfolg angestrebt.
- Adressatengerechte Ansprache von Stakeholdern durch Entwicklung von Kommunikationsstrategien,
- Schaffung von Kommunikationsarenen zur Förderung des Dialogs zwischen den Akteuren,
- Stärkung des touristischen Bewusstseins durch Sensibilisierung für die Bedeutung der Zusammenarbeit,
- Ressourcenoptimierung und Agilität durch bessere Koordination der Stakeholder.
Umsetzung
Um das Projekt praxisorientiert umzusetzen, wird ein Service-Design-Ansatz verfolgt. Dieser iterative Prozess konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Stakeholder.
- AP1 «Kickoff»: Festlegung des Projektumfangs und der Rollenverteilung
- AP2 «Verstehen»: Literaturrecherche und Best-Practice-Analyse zum Stakeholder-Management
- AP3 «Beobachten»: Untersuchung Stakeholder-Management für besseres Verständnis der Situation
- AP4 «Definieren»: Entwicklung von Ideenkonzepten basierend auf den erhobenen Daten
- AP5 «Prototypisieren»: Erstellung von Prototypen und Planung der Umsetzung
- AP6 «Testen»: Überprüfung der Wirksamkeit der Prototypen und Anpassung bei Bedarf
- AP7 «Dokumentieren»: Erstellung Abschlussbericht und Verbreitung Erkenntnisse
Team
Weiterführende Information
Beteiligte
Das Projekt wird vom Institut für Tourismus und Freizeit (ITF) in Zusammenarbeit mit Heidiland Tourismus, St.Gallen-Bodensee Tourismus, Toggenburg Tourismus und Thurgau Tourismus umgesetzt.